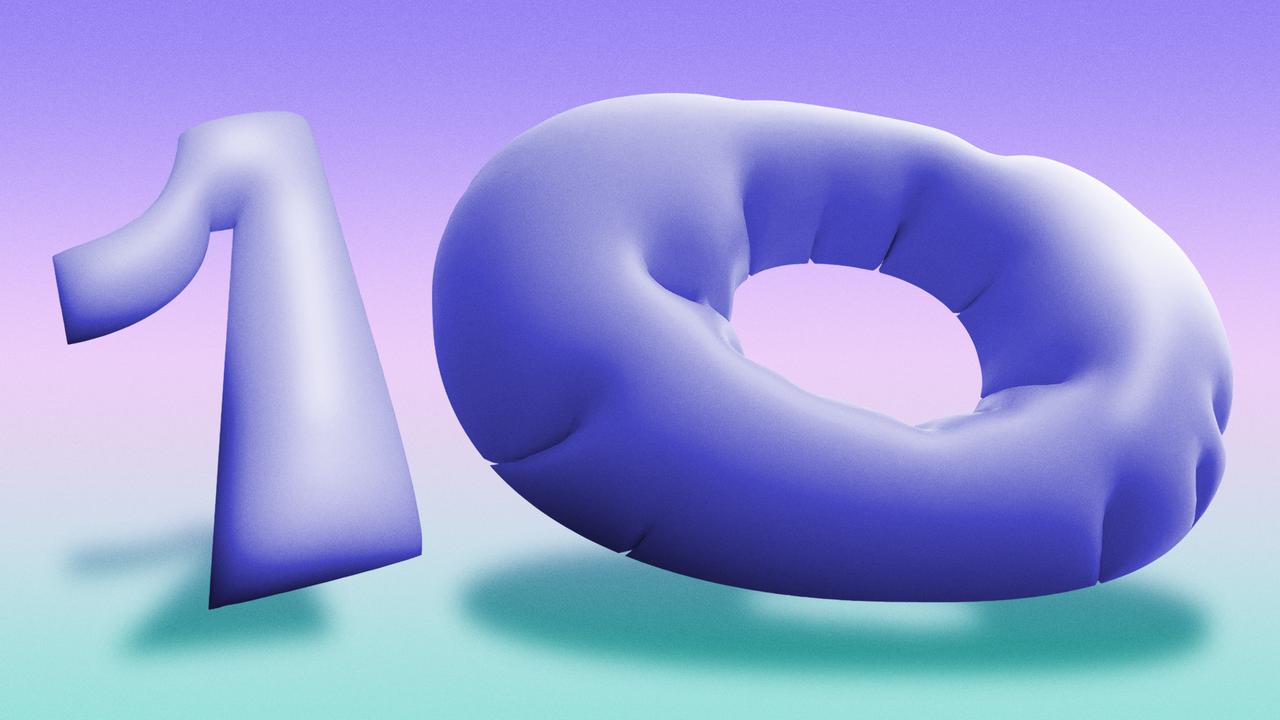Lust und Funktion als ParallelweltenFilmkritik: „Motel Destino“ von Karim Aïnouz
10.12.2024 • Film – Text: Mariann Diedrich
Foto: Acervo/Globo Filmes
Der brasilianische Film „Motel Destino“ wurde dieses Jahr in Cannes uraufgeführt und läuft seit einiger Zeit in den deutschen Kinos. Ein eindringlicher, aber auch extremer Blick in die brasilianische Gesellschaft. Mariann Diedrich hat sich den Überraschungshit angesehen.
Ist Motel Destino ein Ort? Oder Fügung? Ist es, wie es der Name bereits andeutet, Ziel oder Schicksal? Motel Destino ist zunächst ein Stunden-Motel an der Küste im nordbrasilianischen Ceará. Und so schillernd wie der Name ist auch die soghafte Anziehung, die von diesem Ort ausgeht. Hier sucht der 21-jährige Heraldo (Iago Xaver) nach einem misslungenen Mordauftrag Zuflucht und versucht als billige Arbeitskraft seiner sozialen DNA, die ihn zu einem Leben in der Bandenkriminalität verdammt zu haben scheint, zeitweise zu entkommen. Im Motel trifft er auf die selbstbewusste Dayana (Nataly Rocha), die unter nicht weniger belasteten Bedingungen das Motel zusammen mit ihrem chauvinistischen, gewalttätigen Ehemann Elias (Fábio Assunção) führt.
Nach einem Drehbuch des Schriftsteller Wislan Esmeraldo kreiert Karim Aïnouz mit dem queeren Erotikthriller eine Übersetzung des Neo Noir ins tropische Setting – im Netz kursiert dazu bereits der verführerische Begriff Tropical Noir. Zwischen Dayana und Heraldo entwickelt sich eine zärtliche und innige Liaison, die den Auftakt bildet für eine Odyssee der Entgrenzungen und den beiden zum existentiellen Verhängnis wird. Währenddessen fixiert sich der Plot auf das Motel als Dreh- und Angelpunkt und verlässt nur selten dessen pastellfarbenen Wände. Mit beeindruckender atmosphärischer Präzision erzeugt Karim Aïnouz eingehende Bilder in flimmernden Neon-Kontrasten, in einem Dunst aus Sex, Verlangen, Angst und Gewalt, wo sich an den Peripherien des Motels karge Küstenlandschaften in der Dehnbarkeit samtblauer Nächte auflösen und sich Palmenkronen in der Tropenbriese wie aus der Zeit gerissen wiegen. Im Inneren des Motels verdichtet sich derweil das Stöhnen der Motelgäste, das durch die Wände dringt, zu einem betörenden Hintergrundrauschen und verwandelt den Arbeitsort von Heraldo und Dayana in einen Maschinenraum aus orgastischen Salven. In dieser Geräuschkulisse wird gearbeitet, Tag und Nacht. Hier werden die Zimmer geputzt, Bettlaken abgezogen, benutzte Kondome von den Bettarmaturen gesammelt, Räume desinfiziert, Handtücher sorgfältig zu Schwänen drapiert.
Und da das Motel nicht nur Arbeits-, sondern auch Wohnort des plötzlichen Dreiergespanns von Dayana, Elias und Heraldo ist, wird in dieser Geräuschkulisse auch gekocht und gegessen, erzählt und gestritten, gefickt und gelacht, getrunken und geschlagen. Manchmal führt der omnipräsente Sex der Motelgäste auch zu ihrer Erregung, gehen Arbeitsalltag und subjektives Verlangen fließend ineinander über. Und dann findet Arbeit wieder isoliert zu den eigenen Empfindungen statt, stehen Lust und Funktion als Parallelwelten taub nebeneinander, während zwischen den endlosen Stunden des Motel-Lebens die Rhythmen von Tag und Nacht verschwimmen.
Klaffende Widersprüche
Wo es Aïnouz gelingt, Sexualität so direkt, allgegenwärtig, intensiv wie beiläufg zu arrangieren, lässt er die Normalität und Entgrenzung von misogyner Gewalt auf einer anderen Ebene sprechen. Anstatt diese vorzuführen und auszuleuchten, arbeitet Aïnouz hier vermehrt mit Assoziationen. Die Gewalt wird erzählt, sie wird rekonstruiert, selten wird sie jedoch gezeigt und wenn, nicht auf jene blutdürstige oder rohe Weise, wie man es bei einem Erotikthriller vorschnell vermuten würde. Diese eher implizite Verhandlung von Gewalt trägt nicht unwesentlich zu der Sogkraft des Films bei. Denn nur, weil sie nicht sichtbar ist, ist sie nicht weniger spürbar und eindringlich.
Die schwere Brutalität und die Normalität von häuslicher Gewalt bleiben ebenso wenig retuschiert wie der diabolische Kreislauf des gewaltvollen Milieus von Bandenkriminalität und Drogenkartellen. Aïnouz macht all das sichtbar, ohne es auszustellen. Er zeigt Dimensionen von Gewalt auf, ohne sie zu instrumentalisieren. Die übergangslose Aneinanderreihung der Ereignisse in dem Film stehen dabei wie exemplarisch für den rasanten Austausch von Intensitäten und den klaffenden Widersprüchen, die mindestens der brasilianischen, mehr jedoch der Gesellschaft als solcher eingeschrieben sind. Was sich die Kehle abdrückt, begehrt sich im nächsten Moment obsessiv, was sich gerade noch haltlos fickt, überschüttet sich mit Benzin – bereit, das zu Asche zu machen, was einen kurz zuvor noch innerlich brennen ließ.
Motel Destino ist weniger ein Ort, als vielmehr ein Diorama der Verstrickungen von Sehnsucht, Projektion, Macht, Gewalt und Unterdrückung, aber auch ein Ort von Zärtlichkeit, Liebe und Handlungsfähigkeit – und dabei von fesselnder ästhetischer Kraft. Motel Destino ist eine Entscheidung. Und der Soundtrack hat dazu nicht weniger Sogkraft – wie symbiotisch fließen Musik und Bild ineinander. Trotz der scheinbar ausweglosen Lage von Dayana und Heraldo lässt der psychedelische bis treibende Sound die Szenen über den Erdboden gleiten und hinterlässt ein Jucken nach dem Repeat.