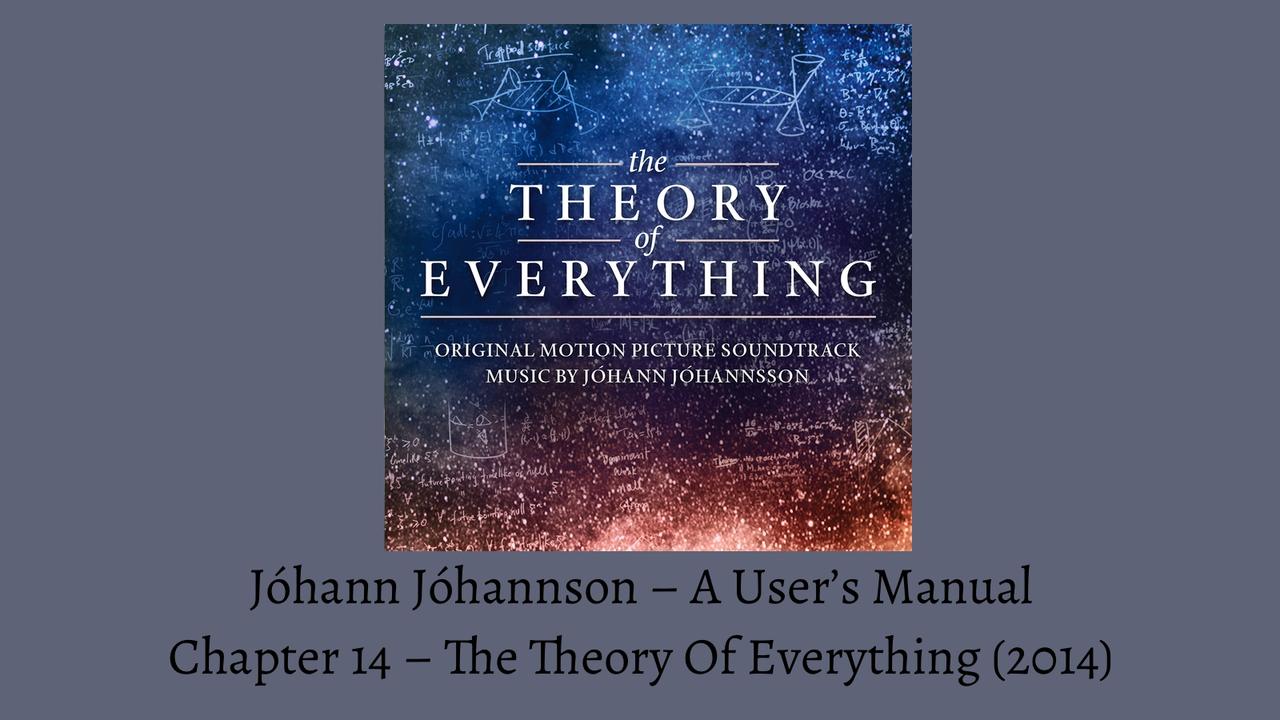Plattenkritik: Depeche Mode – Memento Mori (Columbia)Kein Master, kein Servant. Einfach nur nichts
5.4.2023 • Sounds – Text: Thaddeus Herrmann
Manchmal ist es gut, die neue Platte der Lieblings-Band zwei Wochen liegen zu lassen. Aber: Thaddeus Herrmanns Tränen der Enttäuschung sind noch immer nicht getrocknet.
Depeche Mode. Bei mir gehen da alle Fanboy-Lampen an. Es gibt keine Band, die mich in meiner musikalischen Sozialisierung mehr geprägt hat. Mein Weg mit Martin Gore, Dave Gahan, Andrew Fletcher und Alan Wilder ist lang. Sie haben mich überwältigt – aber auch immer wieder irritiert. Tatsächlich nur manchmal enttäuscht. Einige dieser Enttäuschungen haben sich im Laufe der Jahre in Wohlgefallen aufgelöst. Die „Rock-Platten“ waren mir anfangs zu heftig. Ach Quatsch, ich empfand das als Verrat. Aber je mehr ich mich musikalisch öffnete, desto mehr verstand und wertschätzte ich den Ansatz.
„Memento Mori“ ist eine andere Geschichte.
Nicht nur, weil Andrew Fletcher im vergangenen Jahr gestorben ist. Der gute Andy, ey. Ein paar Basslines auf der Bühne, aber letztendlich bestimmender Geist der Band, der Mediator zwischen den Egos von Martin und Dave, zweier Charaktere, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Gore, der Chef und Songwriter, der immer noch denkt, es sei irgendwie cool und nachvollziehbar, wenn er sich mit 60 Jahren in kaputt-designten Outfits auf die Bühne stellt – in heavy Berghain-Boots, in denen man einfach nicht tanzen kann. Wobei: Manchmal trägt er auch einfach nur T-Shirt – und wirkt dabei erfrischend verletzlich. Und dann ist da Dave. Der verhält sich auf der Bühne ganz anders. Gibt den Rocker. Stiefelt auf seinen Absatz-Stiefelletten umher wie ein Hahn auf Viagra. Wackelt mit dem Po, greift sich in den Schritt und lässt sich feiern. Dass die Gemeinde auf dem Floor der Hallen und Stadien das so hinnehmen, ist das vielleicht größte Problem von Depeche Mode. Die Band weiß genau, dass der Großteil der Fans so verblendet ist, dass sie seit 20 Jahren die gleiche Show spielen kann. Vollkommen egal, was in den ersten 90 Minuten passiert: Am Ende kommen „Personal Jesus“, „Enjoy The Silence“ und „Just Can't Get Enough“. Und Dave weiß ebenso genau, wie die funktionieren. Aber lieber Dave, du bist nicht Axl Rose. Du machst keine Rockmusik, hast aber offenbar nicht den Grips, das anzunehmen. So schade.
Was das alles mit dem 15. Album zu tun hat? Es geht um Sound.
Denn einen wirklich eigenen Sound hatten Depeche Mode nur für ein paar Jahre. So wundervoll das Debüt „Speak & Spell“ und der Nachfolger „A Broken Frame“ (die am meisten unterschätzte LP der Band, imho) auch waren: Technischer Fortschritt und ein kluges Team im Hintergrund waren von ca. 1983-1986 dafür verantwortlich, dass die Band wirklich bei sich war. Die „Berliner Alben“ – „Construction Time Again“, „Some Great Reward“ und „Black Celebration“ – sind Beweis einer klanglichen Transformation einerseits und ästhetischer Konsistenz andererseits. Den damit einhergehenden musikkulturellen Urknall lassen wir mal ganz bewusst beiseite. Mit Daniel Miller und Gareth Jones auf Produzentenseite und dem wissensdurstigen Nerd-Tum Alan Wilders entstand ein Pop-kompatibles Statement. Es geht auch anders. Krasser. Wenn die Melodie stimmt, kann das Sound-Design einfach Sound-Design sein.
Depeche Mode klang immer so, wie es sich die Produzenten (ja, es waren ausschließlich Männer) ausgedacht hatten. Das ging viele Jahre gut, weil auch nach den Berliner Jahren noch eine gewisse Haltung im Studio den Ton angab. Irgendwann zerbrach dieses Konstrukt. Das schien eigentlich nur folgerichtig – die Zeiten waren andere. Techno war omnipräsent. Der Synth-Pop der 1980er-Jahre war nicht länger den lederbejackten Haarspray-Addicts vorbehalten, die elektronische Musik längst Mainstream. „Exciter“ von 2001 war ein Neustart für Depeche Mode – in allen Belangen. LFOs Mark Bell produzierte, die Songs signalisierten Wandel. Dave Gahan war wieder gesund – und Martin Gore offenkundig sehr langweilig gewesen. Seit dieser Zeit und diesem Album folgten die Platten der Band keinem Masterplan mehr. Hit or miss, bestimmt von den klanglichen Vorlieben der Fans.
Für mich ist „Memento Mori“ eher ein miss. Und das hat zahlreiche Gründe. Wenn ich mir die Reviews in den einschlägigen Magazinen zum neuen Album und die Kommentar der mir zum Teil bestens bekannten einschlägigen Fans anschaue, gibt es keinen Zweifel. Es ist (mal wieder) ein Meisterwerk. Ich frage mich: Wie können selbst Hardcore-Fans so unreflektiert mit der Musik ihre Helden umgehen? Die Einordnung in das Schaffen ist das eine, die Analyse der vorgelegten Stücke aber doch das andere?
Und genau die sind – und das ist der erste Punkt – zum Großteil einfach nicht gut. Bislang galt: Die Songs kommen von Gore. Hier und da sprengselte Gahan auch einen oder zwei ein – die tatsächlich auch ziemlich fantastisch waren. „Nothing's Impossible“ zum Beispiel vom 2005er-Album „Playing The Angel“. Für „Memento Mori“ schrieb Gore erstmals nicht alleine. Er tat sich mit Richard Butler zusammen. Ich mochte dessen Band „The Psychedelic Furs“ immer gern, denn natürlich war auch ich mal in Molly Ringwald verknallt. Und die Idee, dass sich Gore einen Sparrings-Partner holt, fand ich noch viel besser. Mit den Ergebnissen kann ich jedoch wenig bis gar nichts anfangen. Dabei geht es nicht um das „Anders“ – vielmehr fehlen die Ideen. Die Texte sind egal und wie ich finde auf die falsche Art und Weise selbstreferenziell. Die Hooks auf die ebenso falsche Art irgendwie lasch. Die große Geste, das Gefühl des Gemeinschaftlichen, die Umarmung mit Melodien und Sounds, ist verkümmert. Dringt nicht durch, ist nicht stark genug, sich zu behaupten. Und hier kommt – als zweiter Punkt – die Produktion ins Spiel.
Produziert hat James Ford. Er war auch schon für den Sound des Vorgängers verantwortlich – „Spirit“ von 2017. Ich schätze dieses Album tatsächlich sehr. Viele gute Songs, hingelegt mit ordentlich analogem Knarz. Der ist seit „Playing The Angel“ bestimmendes Element im Sound von Depeche Mode. Jede Menge analoge Gerätschaften (die es nie brauchte, aber hey) pumpen komplett verzerrte Sound-Bömbchen in den Mix. Hakelige Grooves. Irgendwie ungelenk, aber nur auf den ersten Blick retro. Eine Art bewusste Verweigerung gegenüber dem immer slickereren (und langweiligeren) Techno. Das hatte oft sinnstiftende Kraft – „Delta Maschine“ von 2013 mal abgesehen. Ich erinnere mich gerne an diese Listening-Session im Berliner Büro von Sony Music. Ich saß neben dem geschätzten Spiegel-Kollegen Tobias Rapp, und wir kritzelten uns improvisierte Emojis auf unsere Notizblöcke. Was für eine dämliche Platte! „Memento Mori“ ist nicht so dämlich, aber einfach furchtbar langweilig.
Ich weiß nicht, was James Ford geritten hat. Vielleicht war er im Geiste zu sehr mit seiner eigenen LP „The Hum“ beschäftigt, die Mitte Mai auf Warp erscheint. Vielleicht war er aber auch so abgetörnt von den mittelmäßigen Songs und den Ansagen der ausführenden Musikern. Das Sound-Design ist schlaff. Bestimmt von einer Reihe überflüssiger, weil im konkreten Fall leider vollkommen nutzloser Verzerrungen, die nicht mal wirklich zerren, also irgendetwas wollen. Langeweile auf der ganzen Linie. Hier reißt nichts mit, hier ist nichts auch nur im Ansatz Ausgangspunkt für eine detailverliebte Auseinandersetzung. Und ganz ehrlich: Die Kraftwerk-Zitate, ach Quatsch, -Plagiate, sind nur schwer zu ertragen. Wer arbeitet sich denn wirklich 2023 noch immer an „Trans-Europa-Express“ ab? Was soll das? (Hör' mal weg, Herbert – übrigens auch eine wirklich lame Platte.) Das Mixing von „Memento Mori“ von Marta Salogni ist genauso langweilig. Sie schafft ein wenig Klarheit im Matsch der Distortion, ja. Aber mehr auch nicht.
Aber vielleicht muss und soll das alles so ein. Da gibt es eine Band. Die macht Musik. Und diese Band hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Schreibt in der Regel tolle Songs, die der Sänger dann auf Welt-Tournee mit abgehalfterten Performance-Klischees abreißt. Voll schade, aber vielleicht bin ich mittlerweile auch einfach raus. Eigentlich hoffe ich, dass „Memento Mori“ wirklich die letzte Platte von Depeche Mode ist. Gute Güte, werdet doch nicht zu den Stones. Lasst euer Erbe leben, immer wieder neues Leben entfalten. Genug Geld hab ihr ja wohl verdient. Mir tut das weh, einerseits. Weiß aber andererseits auch, dass mir diese immer noch unfassbaren Momente nie verlorengehen werden. Das macht mich froh.
PS: Die beiden besten Songs auf „Memento Mori“ sind von Dave. Go figure.