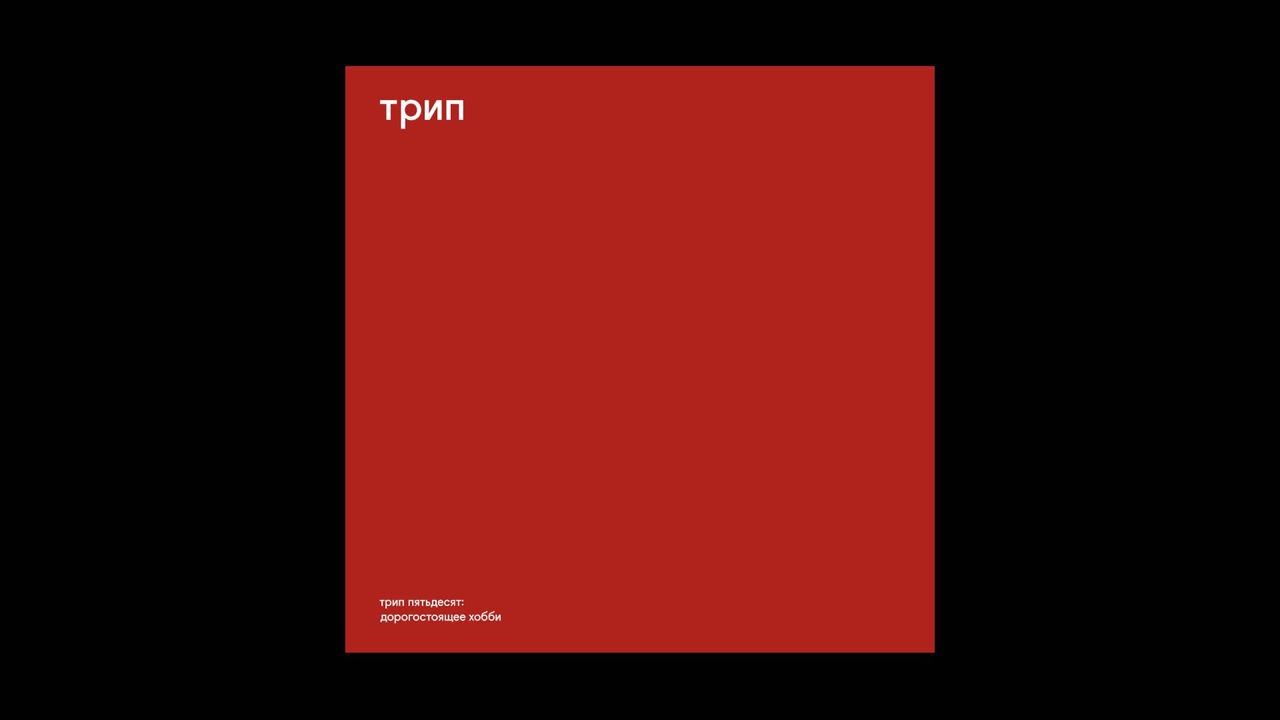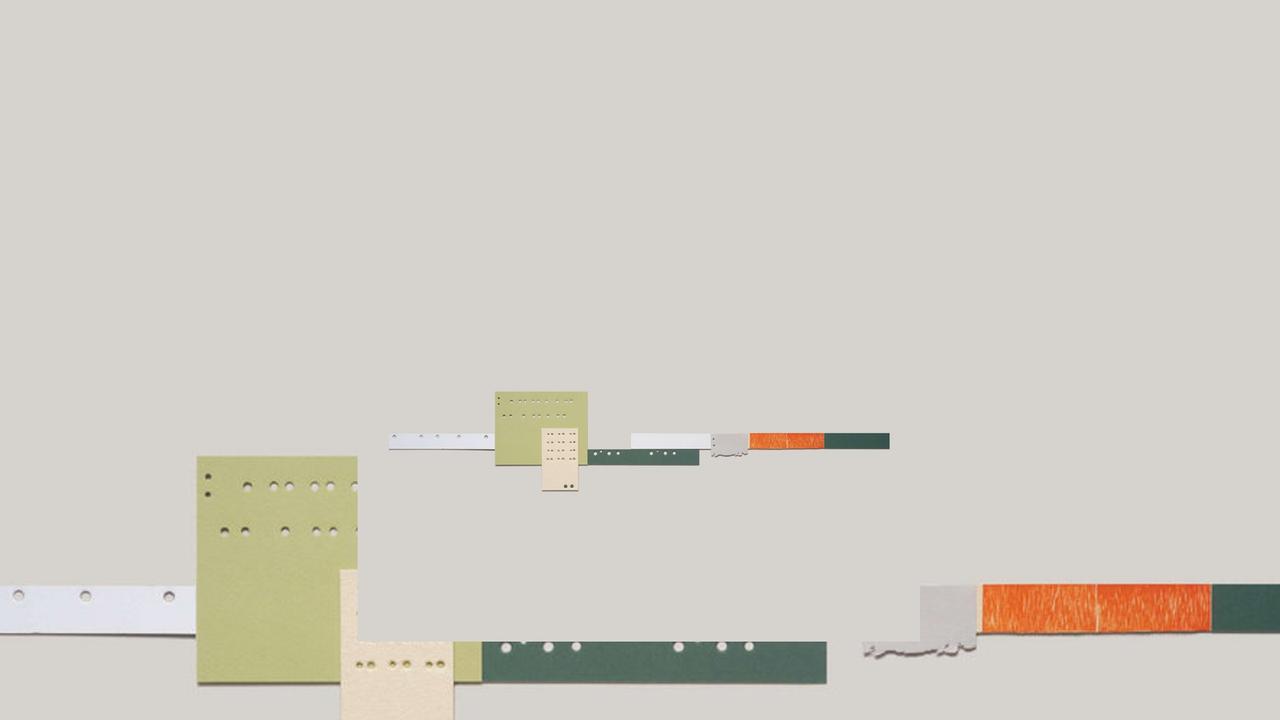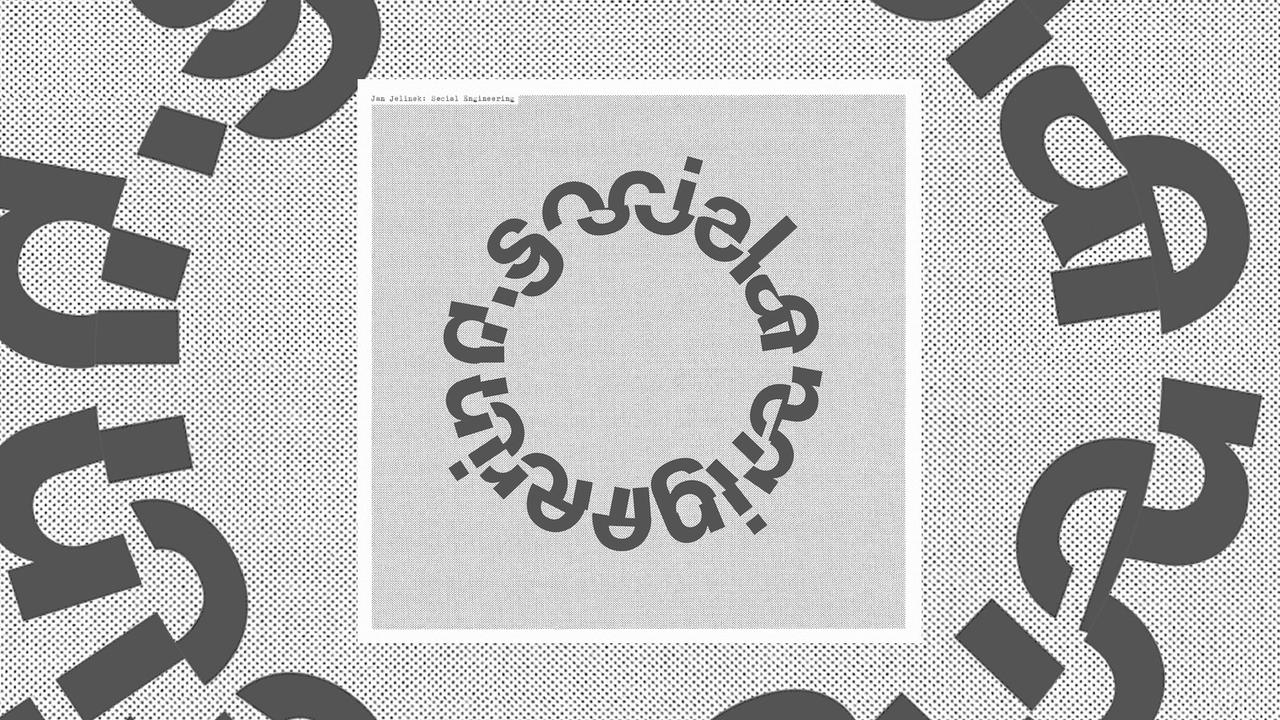Plattenkritik: Orcas – How to Color a Thousand Mistakes (Morr Music)Ecke sucht Kante zum Drogen nehmen und rumfahren
19.7.2024 • Sounds – Text: Thaddeus Herrmann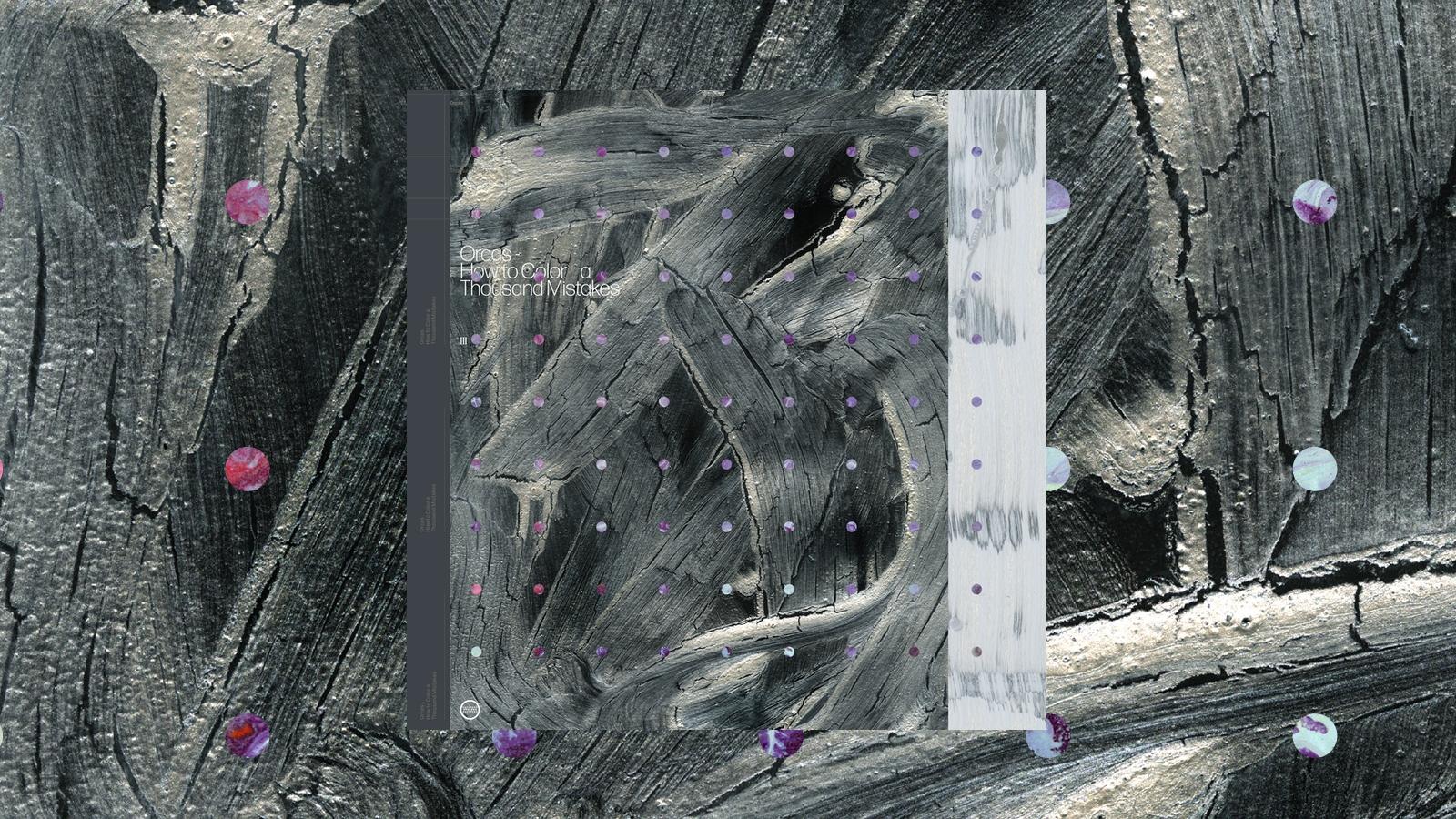
Rafael Anton Irisarri und Benoît Pioulard machen wieder gemeinsam Musik. Zehn Jahre nach ihrem letzten Album klingt „How to Color a Thousand Mistakes“ in seiner shoegazigen Verträumtheit aktueller denn je. Aber reicht das?
Es gibt Musiker:innen, die mich schon sehr lange begleiten mit ihrem Werk. Rafael Anton Irisarri und Benoît Pioulard gehören in diese Kategorie. Kein crazy Fanboy-Shit mit kontinuierlichem Insta-Engagement, sondern vielmehr grundlegender Respekt, immanentes Interesse und unerschütterliche Sympathie sind die Stichworte, die meine Beziehung zu den beiden Musikern prägen. Nach einer Dekade Pause legen die beiden nun ihr drittes gemeinsames Album als Orcas vor. Natürlich kann ich mich an die beiden Vorgänger nicht mehr erinnern. Muss ich aber auch gar nicht. Die zehn neuen Tracks bieten reichlich Stoff.
Es geht um Pop. Um Songs. Um träumerische Perfektion, samtig verpackt und produziert in einem Sound der perfekter nicht sein könnte. Elegische Synths, lange Hallfahnen, schmachtende Echos, verwaschene Gitarren und Hooks, die nicht mehr aus dem Kopf wollen, ganz egal wie zurückhaltend die Songs hinter der lauten Wall of sound auch sind. Slowdive-Drummers Simon Scott spielt Schlagzeug, Martyn Heyne Fender Rhodes, zahlreiche weitere Musiker steuern Input bei. Das läuft alles wie geschmiert.

Foto: Molly Smith
Ich fühle mich erinnert an Nächte im Londoner Camden Palace, im Berliner Dogwash, an zahlreiche Nächte, in denen britische Indie-Bands mit Gitarren und Marshall-Wänden ihren Erfolg in UK in Richtung eines kleinen, eher skeptischen Publikums in Berlin warfen, an einem Dienstag oder Mittwoch. Denn der Orcas-Sound zeigt sich auf „How to Color a Thousand Mistakes“ durch und durch britisch. Kommt – wenn es um Zuordnungen geht – nicht aus der 4AD-Ecke, sondern vielmals aus dem Creation-Universum. Tatsächlich erinnert mich „Wrong Way To Fail“ sehr an Ride. Der Sound der Tracks hat eine gewisse Intimität, ist dabei immer latent psychedelisch – also 60s – und in seiner Produktion so tief in den frühen 1990er-Jahren verwurzelt, dass es schon vier Hände braucht oder bräuchte, diese Roots an die Oberfläche der Gegenwart zu befördern. Dafür ist wohl Produzent James Brown verantwortlich. Er hat in der Vergangenheit zum Beispiel mit den Arctic Monkeys und Kevin Shields gearbeitet. Und mit den Nine Inch Nails. Das hört man aber eher gar nicht. Das gilt auch für die eher „zeitgenössischen“ Sounds und Ideen. Natürlich pulsen diese in der Produktion immer irgendwie mit, vergnügen sich aber eher als Backdrop im gut gepolsterten Liegestuhl der Referenz. Das fühlt und hört sich schon alles toll an.
Vielleicht auch, weil mich dieser von Grund auf nicht neue Sound eben an so viele Dinge erinnert. Benoît Pioulard croont sich so sensationell verliebt an den Gesang von Johan Duncanson von The Radio Dept. ran, dass ich alles stehen und liegen lassen und wochenlang nur deren alte Platten hören möchte. Um diesen idealisierten Sound wieder in die Realität zurückzuholen. Denn so glatt und poliert war und ist das alles nicht. Schade, dass genau das hier ein bisschen verloren geht. So bleiben zehn Tracks, die bestimmt auch Coldplay-Fans gefallen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Die Musik von damals kann nur auch heute noch viel mehr. Ich hätte mich über ein paar Ecken und Kanten gefreut. Oder den Versuch, dieses Gigantische Ganze auf 8-Bit zu komprimieren und dann wieder drüber zu spielen. Um zu schauen, was passiert. Was möglich ist. Denn möglich ist hier viel.