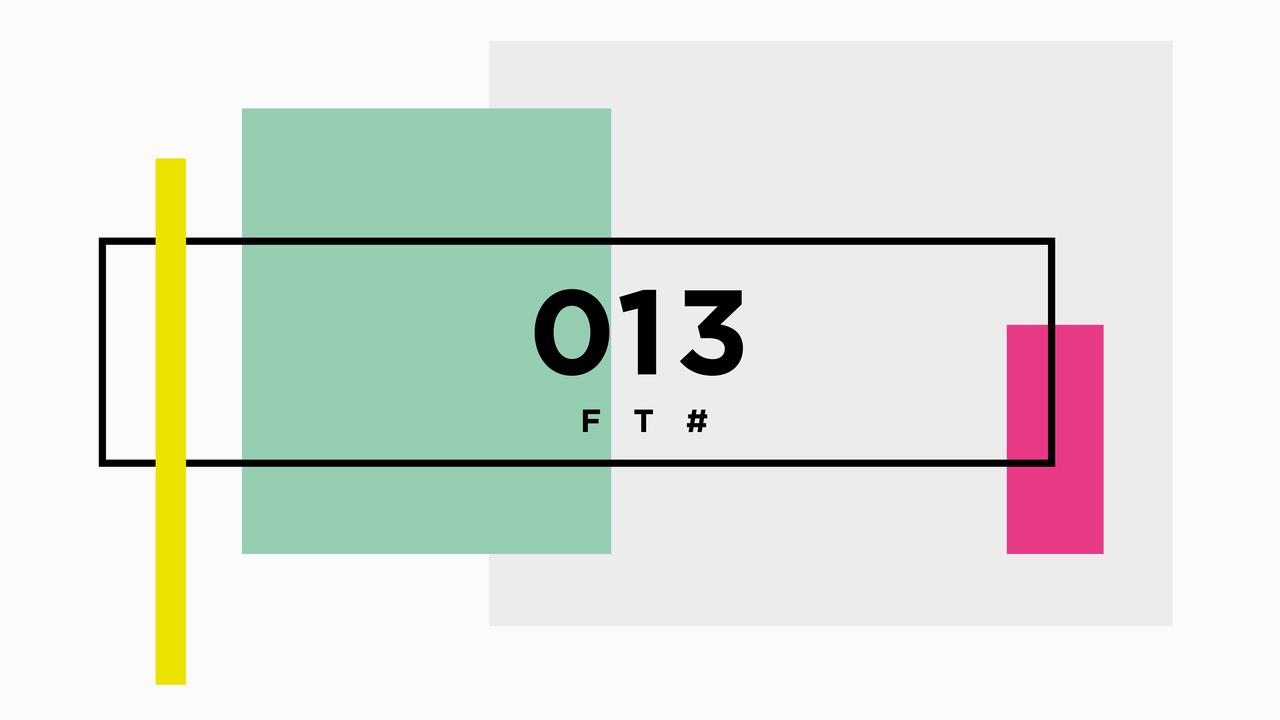„Es gibt keinen perfekten Song!“Der Musiker Toro Y Moi im Interview
8.4.2015 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim
Foto: Andrew Paynter
Der in Kalifornien lebende Chaz Bundick ist spätestens seit seinem gefeierten Debütalbum „Causers of this“ von 2010 der Prototyp des Indie-Posterboys 2.0 geworden. Sein Projekt Toro Y Moi vermählte Pop, Elektronik, House, Psychedelic und Indie derartig perfekt, dass Anfang der 10er-Jahre Musikjournalisten sogar ein eigenes Genre dafür schufen: Chillwave nannte sich die Gattung, die rückblickend betrachtet die Halbwertszeit eines abgelaufenen Joghurts hatte, aber Chaz ohne Frage einiges an Aufmerksamkeit brachte.
Im vergangenen Jahr veröffentlichte er mit seinem Nebenprojekt Les Sins ein lupenreines Clubalbum. Sein dieser Tage erscheinendes neues und fünftes Toro-Y-Moi-Album „What For!“ klingt dafür so organisch und nach Liveband wie noch keines zuvor in seiner Laufbahn. Neben seinen hinlänglich bekannten Producer-Skills beweist Chaz Bundick hier vor allem auch sein Talent als großartiger Songwriter und seine Liebe zu spacigen Sounds aus den 70er-Jahren. Ohne Zweifel ein Highlight von einem Pop-Album. Wir trafen Chaz zwischen Soundcheck und Konzert in Berlin-Kreuzberg. Wie faszinierend, dass der 28-Jährige in realitas noch jünger und elfengleicher wirkt als auf seinen Fotos. Jovial, smart, von zarter Gestalt und mit reizendem Lächeln. Ihm würde man nichtmal verübeln, wenn er in die Urne deiner Eltern kotzen würde – und das muss man erstmal hinkriegen. Wir sprachen mit ihm über die Perfektion eines Weezer-Albums, wieso er froh ist, in seiner Teenager-Zeit nicht mit Musikblogs aufgewachsen zu sein, langweilige Grafikerjobs für Politiker und die gute alte Droge Wettbewerb.
Was ist eigentlich aus Chillwave geworden?
(Lacht) Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich mag es ja, wenn sich Dinge verändern und weiter entwickeln. Aber ganz ehrlich, so wirklich interessiert hat mich diese Bezeichnung eigentlich nie.
Heute existiert Chillwave auch nicht mehr. Es ist tot.
Absolut.
Aber rückblickend. Wie hast du diese Zeit miterlebt? Eventuell hat dir dieser Hype ja auch eine Menge gebracht.
Ohne Frage war die Zuschreibung und der Hype hilfreich für meine Karriere. Ich mache noch immer Musik und bin sehr glücklich darüber. Ich kann aber nicht sagen, dass ich jemals zu hundert Prozent dahinter stand. Mir ging es nie darum, Chillwave zu machen.
Letztes Jahr hast du mit deinem Projekt Les Sins ein erstes Album veröffentlicht. Dabei geht es eher um cluborientierte Dance-Tracks. Dein neues Album als Toro Y Moi klingt unterdessen organischer als je zuvor. Zu Beginn stand dieses Projekt ja auch für die schönen Schnittstellen, die zwischen Elektronik, House und Indie entstehen konnten. Hast du diese Bereiche bewusst getrennt?
Ich mag einfach viel Musik. Ob elektronisch, Rock oder Indie. Ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann ein rein akustisches Gitarrenalbum aufzunehmen. So viele Vorlieben kann man schwierig in ein einziges Projekt zwängen.
Wie stehst du zu Clubmusik?
Wenn ich an Dance-Musik arbeite, dann geht es mir dabei viel um Aspekte wie Sounds, Produktion, Frequenzen und andere technische Prozesse. Das sind Facetten, die mir bei Les Sins wichtig sind. Wohingegen es bei Toro Y Moi eher um Songwriting, Texte, Harmonien und Akkorde geht.

Toro Y Moi, What For?, ist auf Carpark Records erschienen.
Worum geht es dir beim Songwriting?
Es ist zunächst erstmal ein Kanal oder Ventil für meine Ideen und Gedanken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so lange damit beschäftigen würde. Die ganze Sache ist in meinem Leben ja auch größer und wichtiger geworden.
Wie meinst du das?
Größer auch im Sinne von Publikumszahlen bei Konzerten. Es gibt eine größere Fanbase als noch vor fünf Jahren. Musik muss dabei interessant bleiben, sich weiter entwickeln. Ich will mich nicht dabei langweilen und auch Fans anderer Stile für meine Musik begeistern.
„What For?“ klingt nach einer Livestudioproduktion mit einer richtigen Band. War das so oder wie hast du diesen Sound hingekriegt?
Auf der Platte kommen die Sounds zum Großteil von mir. Die Grooves habe ich mit meinem Drummer Andy aufgenommen. Ich habe in der Tat viel experimentiert, damit es wie eine Livestudio-Produktion mit Band klingt.
Was braucht ein perfekter Song?
Zunächst: Es gibt keinen perfekten Song. Oft sind vermeintlich perfekte Sachen an vielen Stellen unperfekt. Oder schau auf diesen Tisch hier. Die Form ist simpel, es ist gut gelöst. Ich mag die Einfachheit, nie mehr hinzuzufügen als nötig. Eine einfache Idee, die gut umgesetzt wird – darum geht es bei einem perfekten Song.
Hast du ein Beispiel?
Das blaue Album von Weezer. Das sagen aber einige.
Und wieso nicht Pinkerton? Das wäre ja mein Favorit.
Auch großartig. Das blaue Album hatte mich aber eher geprägt, auch weil es schon davor erschien. Es ist ein gutes Beispiel für Einfachheit. Das Cover: vier normale Typen vor blauem Hintergrund, zehn Tracks, alles in weniger als 40 Minuten. Nichts wird aufgeblasen. Das ist eine Referenz.
In den 90ern hast du poppigen Punkrock von Bands wie Blink 182 gehört. Jetzt geht es mit deinem Sound wieder zurück Richtung Indie. Kehrst du zu deinen Ursprüngen zurück, oder warst du von elektronischen Laptop-Sets gelangweilt?
Nicht wirklich gelangweilt. Wie gesagt, mir geht es darum, Musik interessant und spannend zu halten. Skateboarden und Indie Rock haben mich in meiner Jugend viel beschäftigt. Dass ich Bands wie Blink 182 gehört habe, lag aber auch daran, dass es noch keine Musikblogs gab, die einem verboten haben, diese Band zu hören (lacht). Als deren Album „Enema of State“ herauskam, dachte ich: Das sind doch gute Songs mit einer wirklich guten Produktion.
Fährst du noch immer Skateboard?
Ich pushe herum, mache aber keine Tricks. Ich habe nie besonders abgefahrene Sachen gemacht. Dennoch fühle ich mich der Kultur sehr verbunden.
Bist du auch vorsichtiger geworden?
Durchaus. Unser Bassist hat sich am Tag seiner Uni-Abschlussfeier die Beine beim Skaten gebrochen. Furchtbar. Das war ein Zeichen für mich, es mit dem Skaten ein bisschen konservativer angehen zu lassen. Mit solchen Verletzungen ist selten gut Musik zu machen.

Foto: Andrew Paynter
„Ich habe Klavierstunden schon immer gehasst. Das war der Grund, wieso ich keine Musik studieren wollte. Ich wollte nicht den Spaß am Musizieren verlieren.“
Wo wir gerade über deine musikalische Sozialisation in den 90ern gesprochen habe – Indie scheint bei den großen Revival-Hypes in den 2000/2010er-Jahren bislang keine große Rolle zu spielen. Anders bei House oder HipHop.
Ich kenne viel aktuelle Musik, die aus der Zeit beeinflusst ist und die ich sehr schätze. Ich finde die Sachen von Alex G großartig. Das Label Orchid Tapes veröffentlicht in dem Bereich viele spannende Sachen. Es gibt zur Zeit einige inspirierende Acts mit Indie-Hintergrund. Einige von ihnen werden mit Sicherheit noch erfolgreich, vielleicht sind sie nur noch nicht auf jedermanns Schirm.
Wie da wären?
Mac Demarco finde ich super. Der macht unglaubliche Sachen, für mich einer der absoluten Favoriten, was die Zukunft der Gitarrenmusik anbetrifft.
Kann ein Mac Demarco je so groß werden wie Sonic Youth?
Gute Frage. Sonic Youth wussten zu Beginn doch aber auch nicht, dass sie irgendwann zu lebenden Legenden würden. Die waren halt von Beginn an konsequent und haben ihr Ding durchgezogen. So was macht sich am Ende bezahlt.
Du meintest mal, dass du Remixe nutzlos und banal findest. Wie meinst du das?
Es spielen bei Remixes irgendwie immer Dinge wie Geld oder auch Publicity eine Rolle. Ab einem gewissen Punkt wollte ich mich davon freimachen. Ich habe auch nie diesen Drang gefühlt, Remixe machen zu müssen. Bei mir war es eher so: Ach cool, es gibt Geld dafür? Wieso nicht. Damals kam ich gerade vom College und konnte das Geld gut gebrauchen. Zur Zeit komme ich mit meiner eigenen Musik gut aus. Ich kann mir mehr Zeit für meine eigenen Entscheidungen nehmen.
„Musik ist für mich etwas Besonderes. Es gibt wenige Dinge, die für Menschen so bedeutsam sein können. Ich will meine Musik nicht ausschließlich auf Erfolg ausrichten.“
Eigentlich hast du Grafikdesign studiert, wieso bist du dennoch Musiker geworden?
Ich habe schon immer Klavierstunden gehasst. Das war der Grund, wieso ich keine Musik studieren wollte. Nach dem Klavierunterricht nahm ich Gitarrenstunden. Da hat mir aber auch keiner beigebracht, Blink-182-Songs zu spielen. Ich wollte nicht den Spaß am Musizieren verlieren.
Du tobst dich aber als Designer bei deinen Musikprojekten aus.
Stimmt. Ich mache von Beginn an das Artwork und auch das Design. Ich arbeite gerne gestalterisch.
Hast du je professionell als Designer für eine Agentur oder Kunden gearbeitet?
Einmal. Damals in South Carolina, wo ich ursprünglich herkomme, habe ich Broschüren und Plakate für Politiker gestaltet. Es war der langweiligste Job aller Zeiten. Es ging nur darum, altbackene, typische Muster anzuwenden. Null Kreativität, funktionieren wie ein Uhrwerk, das war’s. Einen richtigen Grafikdesign-Job in der Form hatte ich nie.
Gibt es Ambitionen, mehr in dieser Richtung zu tun?
Ich liebe noch immer Design als Ganzes. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Design in meinem Leben länger eine Rolle spielen könnte als Musik. Musik ist ein Stück weit kompliziert, das Business hat seine Eigenarten. Irgendwann wird man erfolgreicher, man muss mit einem irrsinnigen Druck umzugehen lernen und ab einem gewissen Level wird vieles zu einer Art Wettbewerb. Was ich aber nicht will ist, mit Musik gegen andere konkurrieren zu müssen. Musik ist für mich etwas Besonderes. Es gibt wenige Dinge, die für Menschen so bedeutsam sein können. Ich will meine Musik nicht ausschließlich auf Erfolg ausrichten.

Foto: Andrew Paynter
Musik ohne Wettbewerb? Wie stellst du dir das vor?
Wettbewerb ist wohl eine urmenschliche Angelegenheit. Ich bin ja auch auf dieser Droge. Zum Beispiel, wenn ich etwas Abgefahrenes höre und denke: Fuck, wieso bist du nicht darauf gekommen?!
Du spielst viele Instrumente.
Da gab es immer wieder Missverständnisse und Leute wollten aus mir einen Multiinstrumentalisten machen. Aber eigentlich spiele ich Keyboards, Gitarre, Bass und Schlagzeug.
Was für eine Band durchaus reichen könnte.
Das auf jeden Fall.
Hast du dennoch ein Lieblingsinstrument?
Ich mag es, wenn man eine Bassline zu einem Song hinzufügt. Eine gute Bassline repräsentiert die Seele eines Songs und bringt ihn mit dem Rhythmus zusammen.
Bei „What For?“ sind viele Einflüsse aus den 60ern und 70ern zu hören. Welchen Bezug hast du zu dieser Zeit?
Damals ist viel passiert. In der Politik, aber auch Drogen haben damals die Gesellschaft verändert und Musik hat eine große Rolle dabei gespielt. Unter anderem, dass Menschen sich Gedanken über den Ursprung des Lebens und des Universums gemacht haben, auf eine vollkommen andere Art als zuvor. Das hat auch bewiesen, dass Musik nicht nur dumm und banal ist, sondern dass eine größere Energie transportiert werden kann.
Auch aus Produktionssicht waren die 60er und 70er eine Hochzeit.
Absolut. Diese Trockenheit in den Spuren …
Hast du dich jemals geärgert im falschen Jahrzehnt aufgewachsen zu sein? Nicht mit großen Motown-Orchestern im Studio zu spielen?
Nein. Ich bin sehr glücklich über die Zeit, in der ich lebe. Wie happy ich doch bin, dass es Mobiltelefone und Laptops gibt.
Du hast gerade angedeutet, dass deine Zukunft nicht nur aus Musik bestehen soll. Was hast du dir genau dabei vorgestellt?
Wie gesagt fände ich es spannend, mich mehr mit Grafikdesign auseinanderzusetzen. Ich betreibe mit Company Records mittlerweile ein eigenes Label. Musik zu entdecken und zu veröffentlichen finde ich interessant. Aber allgemein würde ich gerne mehr als Art Director arbeiten. Ob nun für ein Label oder vielleicht auch mal bei einem Magazin. Von mir bewunderte Labels wie Warp, Ghostly oder 4AD haben alle eine starke visuelle Präsenz. So etwas reizt mich auf jeden Fall.
Und dann kommt noch dein akustisches Singer-Songwriter-Album?
Genau. Dafür muss ich aber noch eine passende Holzhütte in einem einsamen Wald finden (lacht).
Album bei iTunes